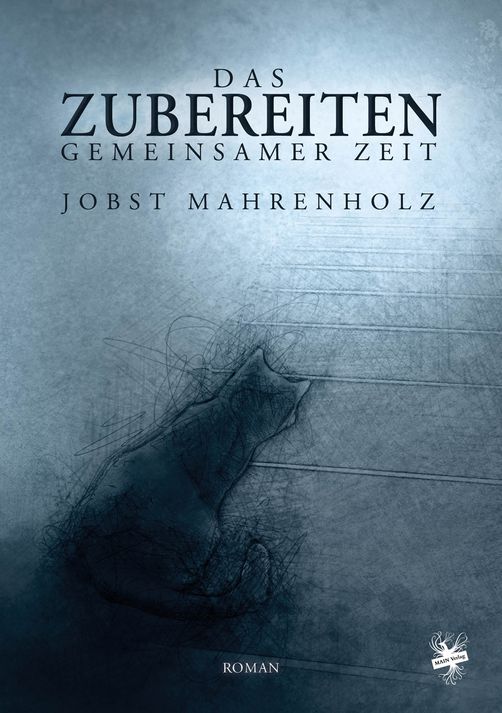Jobst Mahrenholz hat im März seinen Roman „Das Zubereiten gemeinsamer Zeit“ veröffentlicht. In keinem seiner Bücher ist so viel von ihm selbst wiederzufinden wie in diesem. Eine Geschichte, die schroff und kühl, aber gleichzeitig warm und einfühlsam ist …
Wie kann man Sie persönlich und als Autor am besten beschreiben?
Als kantig! Sowohl optisch als auch vom Wesen. Ich ecke oft an. Das bringt mich immer wieder in Konfliktsituationen. Für einen Autor ist das nicht das Schlechteste, denn es hat oft Dialoge über das Gängige hinaus zur Folge.
Worum geht es in „Das Zubereiten gemeinsamer Zeit“?
Zwei Männer begegnen sich im winterlichen Dänemark, an der Nordseeküste. Und sie stellen fest: Da gibt es Überschneidungen. Beide haben sich eine Auszeit genommen, über viele Wochen hinweg. Sie beginnen, Zeit miteinander zu verbringen. Der eine ist ein leidenschaftlicher Koch, kann jedoch wenig bis gar nichts essen, der andere, ein hingebungsvoller Genießer, ist des Kochens nicht mächtig, möchte es aber unbedingt lernen. Das verbindet sie. Einen Teil des Buches habe ich in genau dem Loft geschrieben, in dem gekocht, geredet und gedacht wird.
Sie haben unter anderem Literatur studiert und später als Journalist gearbeitet. Was bewegte Sie zum Schreiben?
Ich wurde als Kind von einem Juristen und einer Psychologin adoptiert. Ich denke mal, diese sehr entscheidende Wendung in meinem Leben hat sowohl den Drang zum Schreiben geweckt als auch meine Faszination für Sprache. Aber eine Idee im Kopf zu haben und sie dann letztlich zu verschriftlichen, sind zwei verschiedene Dinge. Es braucht sowohl die Fantasie als auch das Handwerk. Also fing ich an, mich mit dem Handwerk zu befassen, um dem Wust in meinem Kopf einen passenden Rahmen zu geben.
Was hat sie zum Schreiben von „Das Zubereiten gemeinsamer Zeit“ inspiriert?
Der Auslöser war ein einziger Satz eines Freundes, den ich auf Facebook kennengelernt hatte. Irgendwann gestand er mir, dass sein Profilbild nicht ihn abbildet. „Ich bin hässlich!“, schrieb er zur Begründung. Das hat mich damals sehr berührt. So ein starker, harter Satz. Inspiriert hat mich schließlich ein anderer Freund, den ich sehr liebe, mit dem ich auch einige Zeit in Dänemark verbracht habe. Der Mads in der Geschichte.
Sie sind adoptiert worden. Mads, einer der Hauptcharaktere, hat eine ähnliche Geschichte. Spiegeln sich Ihre eigenen Erfahrungen in Ihren Charakteren wider?
Mads zieht nach dem Tod seiner Mutter zu seinem Vater, der eine neue Familie gegründet hat, ist dort jedoch nicht willkommen. In all meinen Büchern bin ich wiederzufinden, aber in keinem so sehr wie in diesem.
Ihre Bücher werden der LGBTQ-Literatur zugeordnet. Wie sehen Sie das?
Tatsächlich werde ich in eine Ecke gestellt, allein, weil unter den meisten meiner Bücher „queer“ steht, aber das ärgert mich enorm, ist ungerechtfertigt und verursacht ein Schubladendenken, gegen das ich im Grunde anschreibe. Unter Hetero-Büchern steht ja auch nicht „hetero“. Da würde man sich doch an den Kopf fassen. Ich bin ein queerer Mensch, also spiegelt sich das in meinen Texten wider, denn: Will ich authentisch sein, berichte ich über Vertrautes. Das, was meine Geschichten ausmacht, sind Empfindungen, die jeden Menschen betreffen, der fühlt, liebt, hasst, abstumpft oder über sich hinauswächst. Ganz gleich, auf welcher Party er tanzt.
Verstehen Sie die sexuelle Orientierung Ihrer Charaktere eher als etwas Banales und Realität, oder sehen Sie in Ihrem Schreiben auch ein Stück weit einen Bildungsauftrag?
Sex empfinde ich generell als etwas Banales, sei es in der Literatur, im Film oder im real live. Sei er queer, hetero oder sonst wie geartet. Er ist zwingend banal. Aber im Ernst: lässt man den Sex außen vor, ist es nicht banal, queer zu sein, denn da geht es plötzlich um ethische Fragen, um Würde und Respekt, um Politik und Menschenrechte, um Gleichheit und das Recht darauf. In meiner Arbeit thematisiere ich das Queersein bezogen auf die jeweiligen Protagonisten. Die einen haben kein Problem damit, die anderen arbeiten sich daran ab. Ich gebe nicht vor, zu wissen, was richtig, was falsch ist. Das entscheiden meine Figuren ganz für sich. Und so geben sie auch den Lesenden die Chance, sich ein eigenes Bild zu machen. Es ist mir wichtig, relevante Geschichten zu schreiben, Denkanstöße zu liefern und Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.
Der Titel „Das Zubereiten gemeinsamer Zeit“ lässt zunächst darauf schließen, dass man für das Verbringen und Schaffen gemeinsamer Zeit ein Rezept braucht. Ist das so? Oder spielen Sie damit eher auf das Koch- und Essverhalten Ihrer Charaktere an?
Der Titel umfasst in der Tat sowohl das Ess- und Kochverhalten der beiden als auch die zwischenmenschliche Entwicklung. Sie fangen an, Fehler zu machen, und diese Fehler haben Folgen. Würde man es aufs Kochen übertragen, haben sie sich irgendwann nicht mehr ans Rezept gehalten. Mit den Konsequenzen daraus müssen sie dann klarkommen.
Interview: Pia Frenk