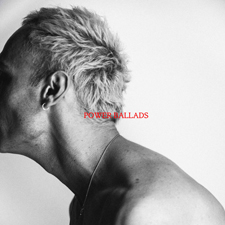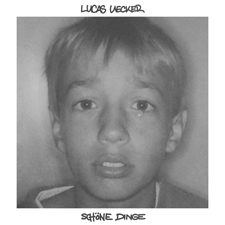Seit Oktober 2019 gibt es für das Land Niedersachsen einen Antisemitismusbeauftragten, dessen Stelle dem Justizministerium zugeordnet ist. Bekleidet wird der Posten ehrenamtlich von Dr. Franz Rainer Enste. Der ausgebildete Jurist war zuvor als Richter in Lüneburg und Stade tätig, hat lange Jahre die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Niedersächsischen Landtags geleitet und war bis 2013 Sprecher der Landesregierung. Wir haben mit ihm über sein breites Tätigkeitsfeld und aktuelle Projekte gesprochen.
Seit Oktober 2019 gibt es für das Land Niedersachsen einen Antisemitismusbeauftragten, dessen Stelle dem Justizministerium zugeordnet ist. Bekleidet wird der Posten ehrenamtlich von Dr. Franz Rainer Enste. Der ausgebildete Jurist war zuvor als Richter in Lüneburg und Stade tätig, hat lange Jahre die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Niedersächsischen Landtags geleitet und war bis 2013 Sprecher der Landesregierung. Wir haben mit ihm über sein breites Tätigkeitsfeld und aktuelle Projekte gesprochen.
Was für Aufgaben hat ein Antisemitismusbeauftragter?
Die Hauptaufgabe besteht sicherlich darin, einen engen Kontakt zu den beiden Landesverbänden zu pflegen, die wir in Niedersachsen haben – also dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen und dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen. Ich stehe aber auch in einem intensiven Kontakt zu den unterschiedlichen jüdischen Gemeinden. Das bedeutet, ich fahre im Land herum, um zu schauen, was die besonderen Anliegen vor Ort sind. Des Weiteren ist es meine Aufgabe, mich um die Sicherheit und den Schutz der jüdischen Gemeinden zu kümmern. Das setzt voraus, dass ich mit den verschiedenen Sicherheitsbehörden spreche, dem Verfassungsschutz, dem Landeskriminalamt, den Polizeibehörden. Schließlich soll ich einmal im Jahr einen Jahresbericht vorlegen und darin die derzeitige Situation der jüdischen Gemeinden darlegen, Verbesserungsvorschläge unterbreiten, was die Arbeit der Landesbehörden angeht, und grundsätzliche Erwägungen aufführen, was das Vorgehen gegen Antisemitismus angeht.
Wie sind Sie zu diesem Amt gekommen?
Während meiner Tätigkeit in der Landtagsverwaltung habe ich mich viel mit Fragen der Erinnerungskultur auseinandergesetzt. So habe ich zum Beispiel die Veranstaltungen, die der Landtag zu Daten wie dem 9. November oder dem 27. Januar ausgerichtet hat, jeweils mitvorbereitet. In diesem Zusammenhang habe ich häufig sehr eng mit Prof. Andor Izsák zusammengearbeitet, der 1991 von Augsburg kommend in Hannover angelandet ist, um ein europäisches Zentrum für jüdische Musik aufzubauen und sakral-synagogale Musikströmungen hier in Hannover zu platzieren. Er war an verschiedenen Gedenkveranstaltungen beteiligt, mit Musikdarbietungen, Erlebnisberichten über die Verfolgungssituation in seiner eigenen Familie, einmal auch mit einer riesengroßen Ausstellung über die Bedeutung der Orgel in der Synagoge. Und bei diesen Gelegenheiten haben wir zusammengearbeitet. Das Gleiche gilt für die großen Konzerte, die er in der Marktkirche organisiert hat und an denen der Landtag beteiligt war. Als dann 2006 die Villa Seligmann erworben und 2012 mit einem starken Konzertprogramm eröffnet worden ist, war ich wiederum das Bindeglied zwischen Landesregierung und den Verantwortlichen der Villa Seligmann. Es gab also immer diese Nähe und diesen Schwerpunkt bei mir, und dann kam 2019 schließlich die Anfrage, ob ich dieses Amt übernehmen möchte.
Sie haben sich aber auch mit historischen Perspektiven des Judentums in Niedersachsen beschäftigt, vor allem im Rahmen des lokalhistorischen Projekts „Wedemark 1930 bis 1950“.
Ja, das ist ein Projekt, das 2014 begonnen hat und jetzt kurz vor dem Abschluss steht. Der dortige Bürgermeister hatte damals die Idee, einen weißen Fleck in der Lokalgeschichte erforschen zu lassen. Es gibt nämlich ein richtig interessantes Phänomen: Es gibt unglaublich gute Dorfchroniken, in denen Lokalhistoriker sehr akribisch alle möglichen Themen aufgearbeitet haben – wie die Dörfer entstanden sind, wie einzelne Straßen und Wege ihre Namen erhalten haben, wie die Wirtschaft zu verschiedenen Zeiten aussah. Das sind ganz akribische, beeindruckende Forschungen – aber sie enden immer irgendwo um das Jahr 1931 oder 1932 und fangen dann erst wieder 1954 an. Was dazwischen war, weiß niemand. Genau das hat dieses Projekt der Erinnerungskultur nun erforschen sollen. Ich selbst bin kein Historiker, aber ich bin damit beauftragt worden, das Ganze als Koordinator zu organisieren, in Zusammenarbeit mit dem Institut für historische Regionalforschung der hiesigen Universität, vor allem mit Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer und Martin Stöber, aber auch vielen anderen Akteuren, etwa der Gedenkstätte Ahlem, der Landesbibliothek, der örtlichen historischen Arbeitsgemeinschaft und dem Institut für Regionalgeschichte in Neustadt. Ein wichtiger Projektpartner war außerdem das örtliche Gymnasium, dessen Leistungskurse Geschichte seit 2015 in diversen Projekten an einzelnen Themen gearbeitet haben.
Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie sich als Antisemitismusbeauftragter mit der Sicherheit jüdischer Gemeinden beschäftigen. Um was für Maßnahmen geht es da?
Um sehr unterschiedliche. Ein Ausgangspunkt für viele Überlegungen ist auf jeden Fall das schreckliche Ereignis in Halle im Jahr 2019 gewesen. Das hat damals den Behörden aufgezeigt, dass es Lücken im Sicherheitsschutz gibt, und zwar sowohl technischer als auch personeller Art. Meine Berufung war ja unmittelbar nach diesem Ereignis, deswegen waren meine ersten Gespräche mit den Gemeinden auch darauf gerichtet, zu erfahren, welche Schutzmaßnahmen notwendig sind und wo sie fehlen, wo nach- und aufgerüstet werden müsste. Um diese Fragen ging es auch in meinen Gesprächen mit den örtlichen Polizeibehörden, dem Staatsschutz und dem Landeskriminalamt. Und dabei wurde bald klar: Es gibt keine Pauschallösung. Jede Gemeinde hat eine andere Lage – die eine liegt zum Beispiel mitten in einer Fußgängerzone, eine andere in einem Einfamilienhausgebiet. Die Situation und die Bedürfnisse sind da von Fall zu Fall sehr individuell.
Solche Schutzmaßnahmen richten sich gegen die extremste Form von Antisemitismus – gewalttätige Übergriffe. Haben diese in den letzten Jahren zugenommen?
Die Zahlen, die ich von der Staatsanwaltschaft und der Polizei habe, zeigen keinen signifikanten Anstieg. Es gibt aber natürlich immer so Wellen, zum Beispiel im Mai, als sich der Nahostkonflikt verschärfte und es in ganz Deutschland vermehrt zu Vorfällen kam. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein subjektives Sicherheitsempfinden derjenigen, die Synagogen oder andere jüdische Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen besuchen. Und diesem subjektiven Sicherheitsbedürfnis muss man Rechnung tragen – gerade angesichts solcher Taten wie in Halle. Hier sind wir nun auf einem guten Weg, alles, was in baulicher Hinsicht getan werden kann, auch umzusetzen. Aber auch das darf man nicht übertreiben. Es kann ja nicht sein, dass jüdische Gemeinden zu Hochsicherheitstrakten werden, von Panzern umstellt und von Stacheldraht umzäunt. Wir müssen also sehen, wie wir den Spagat zwischen Sicherheit und Sichtbarkeit hinkriegen. Viele jüdische Gemeinden wollen sich der Öffentlichkeit präsentieren. Wollen zeigen: „Wir machen hier keine Geheimniskrämerei! Schaut euch das an: Das ist unsere Synagoge, so feiern wir Pessach, so begehen wir den Sabbat, das ist der Hintergrund für unser Laubhüttenfest … alles ganz normal!“ Genau darum geht es bei dem Thema Sichtbarkeit nämlich: Normalität zu transportieren, dem Jüdischen die Attitüde des „Fremden“ zu nehmen. Denn nur so kann eine Normalisierung in den Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionen erwachsen, wenn es gegenseitiges Verständnis gibt, wenn man die unterschiedlichen Ansätze versteht, die man im Christentum, im Judentum, im Islam verfolgt.
Sind nicht-jüdische Menschen in den vergangenen Jahren sensibler dafür geworden, judenfeindliche Äußerungen zu erkennen und zu verurteilen? Oder herrscht da eher Unsicherheit?
Beides. Es gibt durchaus noch Unsicherheit. Der Antisemitismus ist ja nie weg gewesen, er zeigt sich heute aber naturgemäß in anderem Gewand als vor 100 oder vor 50 Jahren. Er ist zum Teil verdeckter geworden. Es gibt viele Formen. Aus diesem Grund führen wir ein Projekt mit RIAS Niedersachsen durch, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Dieses hat den Auftrag, antisemitische – auch strafrechtliche nicht relevante – Vorfälle zahlenmäßig zu erfassen, um diese damit sichtbar zu machen. Das Strafrecht deckt ja nur die Spitze, nur die ganz schweren Fälle ab. Es ist die Antwort des Staates auf das, was er einfach nicht dulden kann, um ein menschliches Zusammenleben zu garantieren. Die Ahndung ist aber nicht ganz einfach. Vor allem Volksverhetzung ist ein schwieriger Tatbestand, zu dem es auch sehr kontroverse Fälle obergerichtlicher Rechtsprechung gibt. Nichtsdestotrotz müssen wir den Antisemitismus bei solchen Ereignissen natürlich erfassen, denn nur so können wir uns ein vernünftiges Bild von der Situation und möglichen Entwicklungen verschaffen.
Welche Rolle spielen dabei Präventions- und Aufklärungsarbeit? Bei einigen Beleidigungen, Sprüchen oder Symbolen ist manchen Menschen nicht einmal bewusst, dass sie aus historischer Sicht eine antisemitische Vorstellung konservieren.
Prävention ist das richtige Stichwort! Ebenso wichtig, wenn nicht gar noch wichtiger als die strafrechtliche Verfolgung ist natürlich die Verhinderung, dass solche Formen des Antisemitismus überhaupt entstehen. Dagegen richten sich die Anstrengungen unter anderem des Landespräventionsrats und des Landes-Demokratiezentrums. Was mich persönlich besonders intensiv beschäftigt, ist die Frage, wie diese Präventionsarbeit in der Bildung geschehen kann. In den nächsten Wochen und Monaten werde ich in Gesprächen mit dem Kultusministerium schauen, was man in der Ausbildung der ErzieherInnen, der GrundschullehrerInnen, der LehrerInnen der Sekundarstufe I und II machen kann, um die Sensibilisierung zu erhöhen, sodass die Verantwortlichen bei antisemitischen Vorfällen – und auch Verdachtsfällen – angemessen reagieren können. Wenn beispielsweise ein Kind zum anderen auf dem Schulhof sagt: „Du Jude!“, dann könnte man denken, das ist dasselbe, wie wenn es gesagt hätte: „Du Deutscher!“, also völlig harmlos. Vielleicht ist es das aber auch nicht, weil es mit einer bestimmten Konnotation gesagt wurde. Es geht dann darum, zu erkennen und beurteilen zu können, ob das betreffende Kind weiß, was es mit seinen Worten auslöst. Die Verantwortung besteht darin, damit pädagogisch angemessen umzugehen. Und das richtig einzuschätzen, ist für viele Lehrerinnen und Lehrer eine Herausforderung – auch nicht überzureagieren, jedoch erst recht nichts unter den Teppich zu kehren.
Ein Aspekt von Sensibilisierung ist auch die Erinnerungsarbeit. Oft passiert diese besonders intensiv um geschichtsträchtige Daten herum – demnächst etwa am 9. November zum Gedenken der Reichspogromnacht. Solche Veranstaltungen haben für viele leider mittlerweile den Anstrich „ritualisierter Betroffenheit“ bekommen, gerade für jüngere Leute, für die sich der Holocaust so weit entfernt fühlt. Wie lässt sich Erinnerungsarbeit gegen solche Abwertungen schützen und wieder relevant machen?
Gleich vorneweg: Von solchen Erinnerungsritualen halte ich überhaupt nichts! Ich halte auch nichts davon, dass man bestimmte Gedenkstätten zu Kranzabwurforten degradiert. Richtig ist, dass wir uns heute selbstverständlich über neue Formen von Erinnerungskultur Gedanken machen müssen. Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Zeitzeugen zunehmend sterben. Das zwingt uns, neue Wege zu beschreiten, zum Beispiel bestimmte Zeugenaussagen durch Videoaufnahmen zu konservieren. Das ist unglaublich wichtig. Aber es ist natürlich auch richtig, dass der zunehmende zeitliche Abstand ein Problem ist. Ich habe schon oft gesagt, dass für Jugendliche, die nach 2000 geboren wurden, das Dritte Reich genauso weit weg ist wie der Dreißigjährige Krieg. Für Vertreter meiner Generation klingt das unglaublich, aber das ist so. Zumal die jungen Menschen heute auch mit vielen anderen Problemen zu kämpfen haben, die ihnen durch die Aktualität sehr viel näher gehen. Und die heutigen Probleme sind ja gewaltig, wir haben den Klimawandel, eine Pandemie … In diesem Zusammenhang mögen sich manche denken: Der Zweite Weltkrieg ist Geschichte, und Geschichte ist geschehen. Deshalb kommt es jetzt darauf an, im Zuge neuer Formen von Erinnerungsarbeit zu zeigen, worum es eigentlich geht – nämlich um ein Bewusstwerden und Bewusstmachen, was damals passiert ist. Wie ein Land seine humane Orientierung verlieren konnte, wie es Ralph Giordano ausgedrückt hat. Aber so etwas funktioniert nicht nur durch die bloße Darstellung monströser Zahlen, sondern durch Bezugnahme auf individuelles Leid. Hinzu kommt, was die Fachleute den „Gegenwartstransfer“ nennen. Es bedeutet, dass Erinnerungsarbeit einen Bezug zur heutigen Zeit, für unser heutiges Zusammenleben herstellen soll. Dass aufgezeigt werden soll, wie damals bestimmte schleichende Entwicklungen zu einer Entrechtung einiger Menschengruppen geführt haben, und wie wir heute aufpassen können und müssen, dass das nicht wieder passiert. Natürlich ist die Bundesrepublik nicht Weimar, das Grundgesetz nicht die Weimarer Reichsverfassung. Aber es ist nun einmal so, dass die Bedrohungen der Demokratie – nicht als Staatsorganisationsform, sondern als Idee des pluralen, liberalen Austauschs zwischen Menschen mit einem maximalen Respekt voreinander – immer wieder eintreten kann. Immer wieder neu, immer wieder anders – aber die Befassung mit den Umständen damals ist ein wichtiger Schlüssel, um zu erkennen, wo die Gefahren heute liegen.
Also geht es darum, die Parallelen in den Anfängen sichtbar zu machen?
Ja. Es gibt ja Leute, die sagen oder denken, am 30. Januar 1933 sei ein Schalter umgelegt worden – Demokratie zu Ende, Diktatur beginnt. So war das natürlich ganz und gar nicht, vielmehr ist dieser Wechsel schleichend passiert. Das Gleiche gilt für die Judenverfolgung und den Holocaust. Schon lange vor Kriegsbeginn wurde immer wieder an dem Schutzwall einer humanen Gesellschaft gekratzt, und das mit der Zeit immer stärker, bis die Sache schließlich kippte. Das ist, denke ich, der vielleicht wichtigste Aspekt von Erinnerungskultur – deutlich zu machen, dass das, was mit Auschwitz endete, lange vorher mit Worten begann!
● Anja Dolatta
Foto: Hans Jürgen Weiß